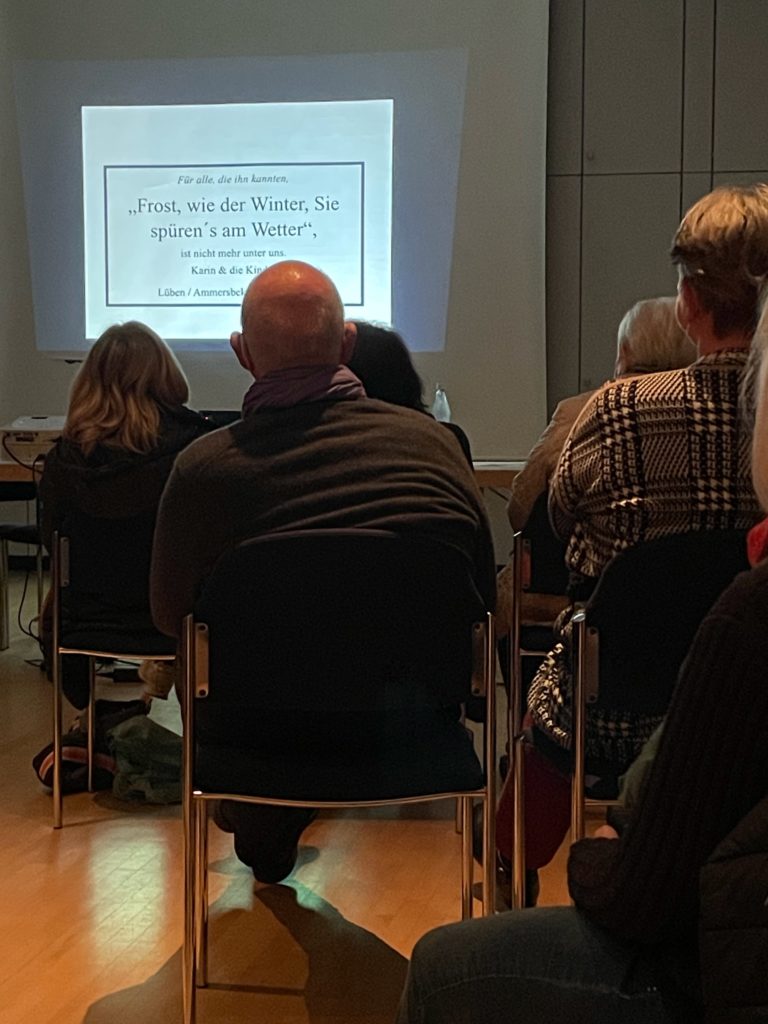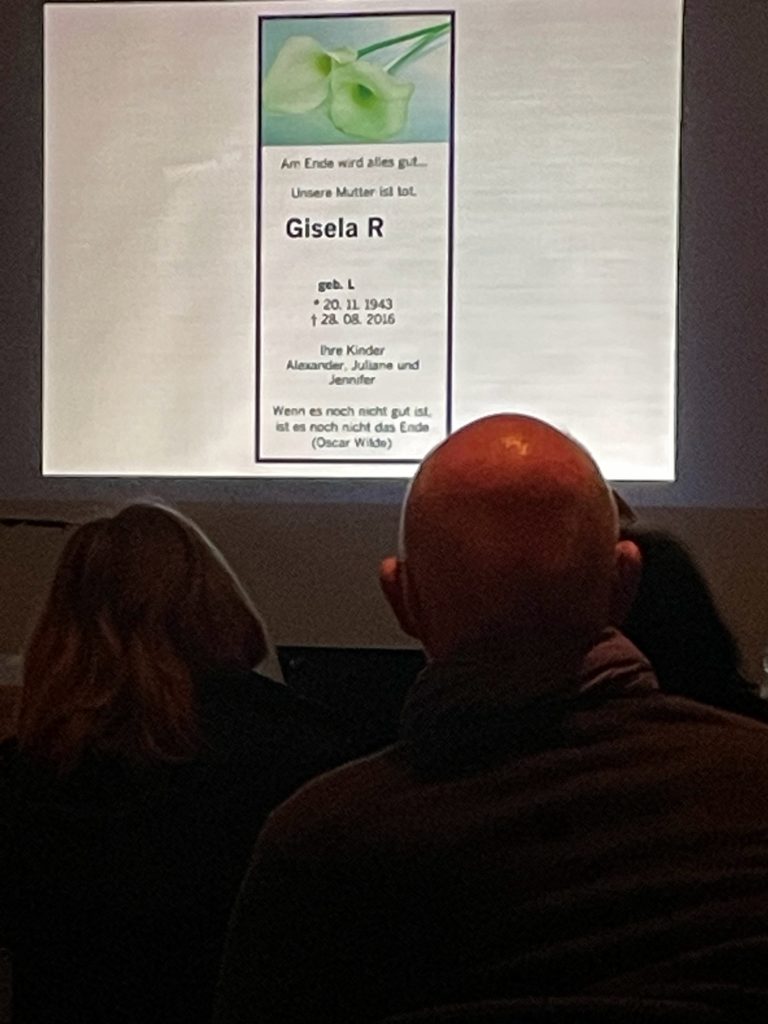Und dem Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe: Das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach dass du kalt oder warm wärest! Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst: Ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts!, und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße! Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! (Offenbarung 3,14-22)
Lauwarmer Laodizeer zu sein, das wäre doch schon was in diesen Zeiten!
Denn um es vorwegzunehmen, liebe Schwestern und Brüder, trotz der besten Vorsätze, die aber allesamt in der Hitze eines außergewöhnlich heißen Sommers getroffen wurden, gelingt es mir zunehmend weniger beim Duschen und Heizen zu sparen. Das sollen wir ja eigentlich, Energie sparen zuhause und anderswo, um einem blindwütigen Gewaltherrscher nicht auch noch die Kassen zu füllen; das scheint – noch! – ansatzweise zu gelingen, aber der Herbst war milde, auch jetzt ist es noch nicht richtig kalt geworden – was wird wohl sein, wenn der Winter so hart wird, wie der Sommer heiß war? – und mir gelingt es schon jetzt immer weniger nur mal schnell und kühl, geschweige denn kalt zu duschen und die Heizung runterzudrehen. Immer wenn Freunde und Kollegen ihre Heldengeschichten von der kalten Wohnung und der kalten Brause erzählen, erschauere ich, halte ganz still und denke bei mir: Wenigstens lauwarm sollte es doch sein.
Der Herr badet gern lau – dieser berühmte Satz, der übrigens passenderweise im Kontext einer Moskaureise einer deutschen Regierung fiel – lang ist es her (1973 mit Kanzler Willy Brandt), und so viel sagen sollte, als dass der damalige Kanzler ein Warmduscher sei, also einer, der die Härte und Kälte des politischen Lebens nicht gut aushält, es lieber bequem hat, den lauen Kompromiss wählt; und schon gar nicht die unbequeme Härte und Kälte des russischen Winters auszuhalten gewillt und in der Lage ist, und der – also ein russischer Winter – natürlich auch dieses Jahr nicht in unserer Gegend zu erwarten ist; in der von der an die Kälte gewohnten Russen überfallenen Ukraine aber schon. Darauf muss man erstmal kommen, den Gegner durch Kälte und Dunkelheit gefügig machen zu wollen. Die Verteidiger ihres Landes haben sich jedenfalls gegen den lauwarmen Weg der Bequemlichkeit entschieden und scheinen bereit zu sein, der Kälte des russischen Winters standzuhalten.
Dass es Situationen und Lebenslagen gibt, die uns Entscheidungen und also Entschiedenheit abverlangen; Entscheidungen, die uns ein lauwarmes Verharren verbieten, genau das meint der Seher Johannes mit seinem Wort an die Gemeinde in Laodizea, das wie sein ganzes Buch ein verschlüsselter Text in schwierigster Zeit und äußerster Bedrängnis ist. Sein: Wer Ohren hat, der höre zeigt an: Hier liegt ein Sinn unter der Oberfläche; hier ist was verschlüsselt; erschließt Euch den tieferen Sinn meiner Worte; denn ich kann jetzt nicht offen reden.
Noch werden die Christen im römischen Imperium verfolgt, Kaiser Nero – sein Name verbirgt sich wohl hinter dem berühmten und satanisch-berüchtigten 666 der Johannesoffenbarung – dieser Nero ist auf neronischen Umtrieben; Christen sehen sich Mordwellen ausgesetzt, angezündet, den Tieren im Colosseum zum Fraß vorgeworfen und also in den Untergrund verdrängt, in die berühmten Katakomben in Rom, Neapel und anderswo verdrängt; christlicher Gottesdienst ist nur unterirdisch, versteckt möglich, im Dunkeln der Grabanlagen; Seite an Seite mit den Toten – und siehe sie leben.
Die Christen in Laodicea waren eine solche bedrängte Gemeinde, die sich Unentschiedenheit eigentlich nicht leisten konnten, wollten sie überleben; aber sie sind sich nach Ansicht unseres Briefautors ihrer misslichen Lage nicht bewusst. Vielleicht halten sie sich durch Randlage in großer Entfernung der Hauptstadt für hinreichend geschützt: was interessiert es den Kaiser von Rom wenn in Laodicea im fernen Phrygien ein Sack Oliven umfällt oder eben eine Handvoll Christen ihre Lieder singen? Vielleicht halten sie sich für reicher als sie tatsächlich sind, weil es ihnen bisher an nichts fehlte: Uns fehlt es an nichts, warum sollten wir etwas ändern? Vielleicht konnten sie sich bisher immer irgendwie durchwurschteln und wissen nicht, dass sie elend und jämmerlich sind, arm, blind und bloß. Wer Ohren hat, der höre!
Als Mithörender solcher verschlüsselten Worte in einer ganz anderen Zeit und unter ganz anderen Umständen fühle ich mich dennoch verstanden, mehr noch: erwischt! Denn auch wir heutigen Christen leben in einer Scheinwelt, machen uns Illusionen, halten uns für andere, Größere, Bessere als wir sind; unsere Kirchen und Gemeinden sind längst Denkmäler verfallener Größe; und wir bloße Scheinriesen, verzwergt in den viel zu großen Anzügen der Vergangenheit; und das sicherlich auch durch Unentschiedenheit: durch unsere Lauheit verzwergt; Religion ist nicht, nicht mehr, was uns unbedingt angeht; Glauben, nicht mehr das, was mich umtreibt und meinem Leben Sinn gibt; sondern bloße Garnierung und Accessoire, der Sahnekleks, wenn überhaupt, auf einem Dasein, dass die meiste Zeit auch ganz gut ohne Gott auskommt; wer braucht eigentlich noch die Weihnachtsgeschichte für Weihnachten? Religiös betrachtet und geistlich gesehen sind wir haargenau so wie die lauwarmen Laodizeer: elend und jämmerlich, arm, blind und bloß.
Aber der Autor macht den Laodizeern und damit uns ein Angebot, das wir kaum ablehnen können; ein Kaufangebot und damit passt es ja ganz gut in die Vorweihnachtszeit, wenn die wichtigste Botschaft die wöchentliche Mitteilung des Einzelhandelsverband ist, ob wir auch alle brav gekauft haben; da müsste doch die eine oder andere Erkenntnisse für unsere jetzt anstehenden Weihnachtseinkäufe drinstecken.
Kauft Gold, weiße Kleider und Augensalbe ruft unser Autor werbend zu; und trifft damit ganz gut die Kauf- und Schenkgewohnheiten, die noch heute zu Weihnachten gelten: Gold, Geld und Schmuck – Gewirktes, Gestricktes und Selbstgestricktes – freiverkäufliche Arzneien, Pülverchen und Tinkturen, streng ohne Rezept aber mit Empfehlung der Apothekenrundschau.
Natürlich hat sich der Autor unseres Briefes mit seinen Kaufempfehlungen was Symbolisches gedacht: das Gold, das er zu kaufen empfiehlt, soll besonders edel sein, besonders rein, im Feuer geprüft, kostbar, haltbar, belastbar, fähig zum Widerstand – anders als wir; und die weißen Kleider, so sauber und rein, so klar, so eindeutig, wie wir eben nicht sind, die wir uns höchstens aufs „Whitewashing“ verstehen, aber eben nicht wirklich ganz sauber sind; und die Augensalbe, mit der wir uns endlich die Augen heil und sauber reiben sollen, um zu sehen, wie es mit uns steht.
Im normalen Geschenkewesen sollte man sich solcher symbolisch-pädagogischer Geschenke lieber enthalten – also nicht nach dem hier zitierten Motto schenken: Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich; wobei an dieser Stelle das Wort züchtigen heutzutage zu scharf klingt; nach dem Original ist eher Erziehung gemeint, also welche ich lieb habe, weise ich zurecht und erziehe ich, was zugegebenermaßen aber auch nicht viel besser ist. Wer will schon als Lesemuffel mit einem Buch „erfreut“ und erinnert werden, dass er einer ist; und wer durch ein Stück Seife daran, dass man Mief und Gemüffel abwaschen kann? Andererseits leben natürlich gerade kostbare Schmuckgeschenke von ihrem Symbolgehalt: So viel bist du mir wert, und noch viel mehr! Aber Achtung: Wer hat schon die Mittel, seine Liebe wirklich in Gold aufzuwiegen? Und für die Liebe meines Lebens müsste es doch schon ein ganz ordentlicher Klunker sein: diamonds are forever! Ein Diamant ist unvergänglich – was schon eine ziemlich religiöse Aussage ist und sicherlich als solche gemeint war.
Mit einem Geschenk lässt sich durchaus Entschiedenheit einerseits ausdrücken oder es drückt sich in ihm bloße Unentschiedenheit, also Lauheit andrerseits aus. Das unpassende, gedankenlos gekaufte, geschmacklose Geschenk kann mehr Schaden anrichten als es ganz zu vergessen: Doppelt Geschenktes, weiter Verschenktes, das geizige Geschenk oder allzu praktische Geschenke kann man sich schenken. Das gelungene Geschenk hält hingegen die Balance zwischen Selbstlosigkeit, Liebeserklärung und Einfühlungsvermögen, was dem anderen eine Freude bereiten könnte. Und nur ein lauwarmer Laodizeer würde sich von solchen hohen Ansprüchen an das Schenken abschrecken lassen: Dieses Jahr schenken wir uns gar nichts, ok Schatz?
Ich glaube das ist der Punkt: Lauwarm heißt, Kosten und Mühen zu scheuen; lauwarm heißt, sich angesichts der Größe einer Entscheidung, sich nicht entscheiden zu wollen; lauwarm heißt, sich den letzten Schritt zu gehen einfach nicht getrauen; in der Liebe wie in der Religion, die sind sich ja sowieso in vielerlei Hinsicht ähnlich. Aber warum sollte ich mit einem Menschen leben wollen, den ich nicht über alles liebe; oder umgekehrt: warum sollte ich nicht mit dem Menschen leben wollen, den ich über alles liebe? Oder warum sollte ich einer Religion angehören, der ich nicht glaube; und abermals umgekehrt: Warum sollte ich ihr nicht angehören – ganz und gar – wenn ich ihr glaube? Es mag Dinge oder Verrichtungen geben, die ganz gut lauwarm zu genießen sind – Duschbäder könnten dazugehören -, aber die wirklich wichtigen erfordern eine Entscheidung.
Auf den alles entscheidenden Moment der Entscheidung kommt es an: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. Das wäre doch wirklich ärgerlich, einen solchen Moment zu verpassen. Und auf den warten wir im Advent.
Amen.