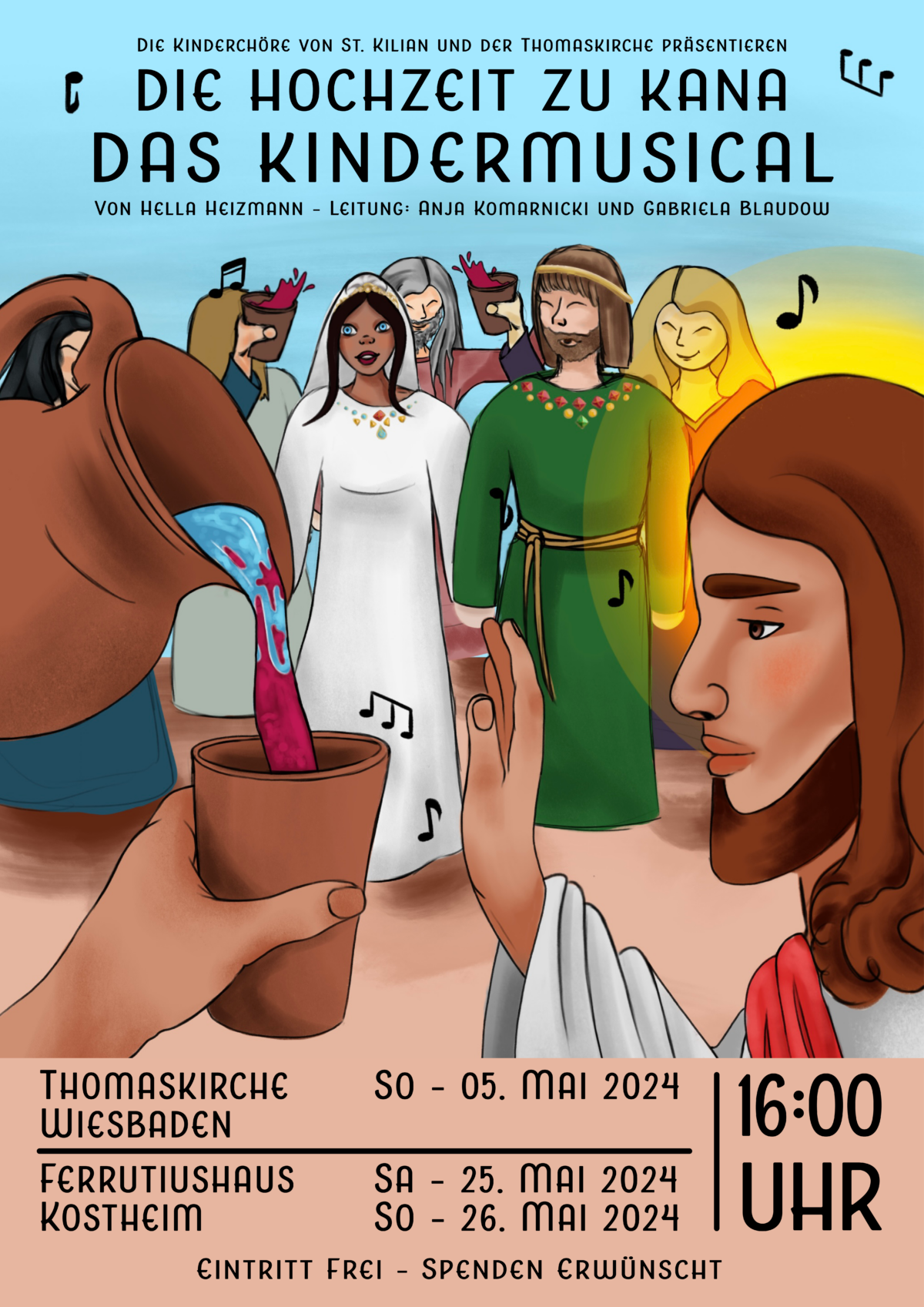Da viele sich rühmen nach dem Fleisch, will ich mich auch rühmen.
… Ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von Juden habe ich fünfmal erhalten vierzig Geißelhiebe weniger einen; ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt worden; dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern; in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße; und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach, und ich werde nicht schwach? Wer wird zu Fall gebracht, und ich brenne nicht? Wenn ich mich denn rühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen.
Gerühmt muss werden; wenn es auch nichts nützt, so will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus; vor vierzehn Jahren – ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht; oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es nicht; Gott weiß es –, da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel.
Und ich kenne denselben Menschen – ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht; Gott weiß es –, der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen; für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Denn wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich kein Narr; denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen; denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark.
(2. Brief des Paulus an die Korinther 11, 18 – 12.10*)
Ehre, wem Ehre gebührt! Jahrestage und Jubiläen, runde Geburtstage und Wendepunkte im Leben laden ein, Rechenschaft zu geben, Bilanz zu ziehen, Versäumnisse nicht zu verschweigen, Leistungen zu loben, Herausragendes zu rühmen: Gerühmt muss werden, sagt der Apostel Paulus. Ehre, wem Ehre gebührt!
Allerdings ist die Ruhmrede, insbesondere wenn sie in eigener Sache geschieht, ein schmaler Grat, von dem man leicht abstürzen kann, oder ein dünnes Brett, das unter der Last unseres Ruhms zu brechen droht. Stimmt´s überhaupt – was wir über uns sagen oder hören? Und sind wir wirklich so toll wie behauptet? Und wie verhält sich mein Ruhm zu dem der anderen? So lässt sich vermutlich jede solcher Reden befragen – und so befragt sich unser Apostel gleich selbst.
Paulus scheint sich dabei selbst auf die Schippe zu nehmen – und legt gleich noch ein zwei Schippen drauf; zweifelt seine eigenen Erinnerungen an, steigert sich in die Prahlerei über seine Missgeschicke und Leiden hinein, wird ganz närrisch darüber – und vergisst nicht, dass an sich schon der Selbstruhm die reinste Narrenrede ist: für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Denn wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich kein Narr; denn ich würde die Wahrheit sagen.
Er erinnert sich – versucht sich zu erinnern, an ein Erlebnis, das vierzehn Jahre zurück liegt; nicht so weit entfernt, dass es ganz vergessen wäre, aber auch nicht so nah, dass man es ganz genau wissen müsste. Von heute 14 Jahre zurück, dass wäre für uns das Jahr 2010: Wie genau erinnern wir uns an die Ereignisse dieses Jahres – eine schrecklich ferne Zeit mit anderem Fußball, anderer Regierung, anderen Problemen; vor Corona, vor dem Krieg in der Ukraine, ja sogar vor dem russischen Überfall auf die Krim, vor dem 7. Oktober, dem Aufflammen von Judenhass weltweit auch bei uns, vor dem Krieg in Gaza; so weit weg und so nah dran?
Wie genau erinnern wir uns an das, was uns damals, lange zuvor berührt, wohlmöglich erschüttert hat – entrückt bis in den dritten Himmel, entrückt in das Paradies : und wir dort Gott begegnet sind, denn das meint Paulus doch – und was uns damit neue Einsichten gebracht, neue Erkenntnisse verschafft hätte, uns eine neue Richtung gegeben hätte, unser Leben verändert hätte? Gab´s das damals – oder wann haben wir das letzte Mal in den Himmel geschaut und das Paradies gesehen? Wann standen wir vor Gott? Bei der Geburt unseres jüngsten Töchterchens? Beim allmählichen Weggang der Mutter aus diesem Leben? Und was davon – von unseren Erinnerungen – könnten, können wir mit Recht Realität nennen, was aber Interpretation, was Deutung – und was dagegen schlicht Irrtum und was sogar Selbstbetrug?
Als Jubilare blicken Sie heute noch weiter zurück: 25, 50, 60 und noch mehr Jahre; in die Jahre 1964, 1974, 1999, – wenn ich richtig rechne – in eine andere, noch fernere Zeit: Ein anderer Fußball jedenfalls, wenn wir etwa 74 nehmen, damals die WM in Deutschland, die für viele das Initiationserlebnis war, diesen Sport zu lieben, ihn aber auch zu fürchten und zu scheuen, wie dann in den langen 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Anders als unser verklärter Blick es zeichnet, brauchte man auch damals schon Glück zum gewinnen, und das waren nicht immer die Besseren, die mehr Glück hatten; auch nicht, wenn es gegen Dänemark ging so wie gestern.
Auch die politische Mannschaft war eine andere, die Weltlage ebenfalls – vor der Wende 1989-90 ganz bestimmt, und wir doch auch. Ich frage mich manchmal, was und wieviel des damals – sagen wir – Vierzehnjährigen, also des Konfirmanden, ich heute noch bin. Gibt es irgendetwas in meinem Körper, ein Organ, eine Zelle, die oder das damals schon bestand; das meiste dürfte sich ja in den vergangenen Jahrzehnten erneuert haben – und vieles eben auch nicht, wovon uns unser Arzt mit sorgenvoller Miene bei den häufiger werdenden Besuchen berichtet. Wenn ich vor 14, 25 oder 50 Jahren körperlich in den Himmel entrückt worden wäre – was ich meines Wissens nicht bin – wäre es jedenfalls nicht in diesem Körper gewesen – ehrlich gesagt würde der das gar nicht mehr hinbekommen, wenn doch schon Flugreisen beschwerliche Strapazen geworden sind.
Und außerhalb dieses Leibes – im Geist, im Bewusstsein, in Gedanken vielleicht? Wenn das geschehen wäre – Himmelsreise und Gottesschau – und wem das geschehen wäre – es wäre einem anderen geschehen, der heute vor ihnen steht, auch ein anderer, der heute Morgen vor ihnen im Spiegel stand. Denn der pubertierende Vierzehnjährige, der noch lange nicht erwachsene Jugendliche, der Konfirmand, der wir damals waren, sind wir nicht mehr. Erlebnisse und Erfahrungen, Erfolge und Niederlagen, Begegnungen und Beziehungen, Zerwürfnisse und Versäumnisse, Freud und Leid über Jahre und Jahrzehnte haben sich ins Bewusstsein gelegt, nein: haben dieses Bewusstsein erst geformt.
Wir sind unsere Geschichte – und in dem Maße, in dem unsere Geschichte sich verändert, wandeln wir uns.
Paulus hält neben dem einen schwierig zu fassenden, in der Erinnerung verblassenden, kaum zu verstehenden, und noch weniger kommunizierbaren Erweckungs-, Bekehrungs- und Berufungsmoment – denn als nichts anderes haben wir seine Himmelsreise und Gottesschau zu verstehen – er hält daneben die unzähligen Kränkungen, Verletzungen, Beschädigungen und Einschränkungen seines Lebens für das, was es prägt und seine Person ausmacht. Und zwar nicht die Kette von kleinen und nicht so kleinen Katastrophen an sich – sondern wie er sie überstehen und in seiner Sicht mit Gottes Hilfe überstehen konnte. So definiert sich sein Leben, er definiert sein Leben als von Gott gegeben – und immer wieder von Gott gegeben, von Gott beschützt, befreit, gerettet, getröstet, erlöst. Nicht Krise und Niederlage selbst machen sein Leben aus, sondern wie Gott ihn daraus errettet hat, der zu ihm sagt: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit.
Ist da was dran? Können wir damit etwas anfangen? Die Konfirmation selbst ist ja bei den wenigsten von uns der tatsächliche Moment unserer Gottesbegegnung, wäre ja auch unwahrscheinlich, beinahe komisch, dass ausgerechnet an diesem Tag in der Thomaskirche Gottes Geist in eine Gruppe von Jugendlichen fährt, um sie in den Himmel zu führen, um ihr Leben zu verändern.
Gemeint ist natürlich, dass wir an diesem Datum gemeinsam unseren höchst persönlichen Moment der Gottesbegegnung feiern; die mag schon zurückgelegen haben, die mag noch vor uns gelegen haben, die mag noch vor uns liegen: diese Reise in den Himmel, dieses Ansehen des Paradieses, dieses Verstehen, wie Gott diese Welt gemeint hat und wie er es mit uns meint, nämlich gut; was sage ich: sehr gut!
Und dass wir von diesem Moment aus nicht nur unser Leben verstehen, wie Gott es für uns meint, sondern dass wir von diesem Moment aus unser Leben bestehen können, in allen Widrigkeiten und Zumutungen. Dass wir es nicht aus eigener Kraft sondern durch die Kraft Gottes bestehen, die unserer Schwäche aufhilft. Dass wir unser Leben aus Gottes Gnade haben und leben. Dass wir mit Paulus sprechen können:
Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen; denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark.