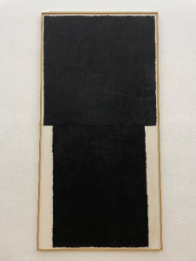Er musste aber durch Samarien reisen.
Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen; es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken! Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. – Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken!, du bätest ihn, und er gäbe dir lebendiges Wasser.
Spricht zu ihm die Frau: Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief; woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten; wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. (Johannes 4,4-14)
Die samaritische Frau soll dem Juden Jesus Wasser reichen. Aber: Wer könnte schon Jesus, dem Christus, das Wasser reichen? Also diese samaritische Frau schon mal nicht, und nicht nur weil sie Samariterin, also aus jüdischer Sicht eine Fremde ist; und nicht nur weil sie eine Frau, also im damals herrschenden patriarchalen Wertesystem dem Mann, jedem Mann untergeordnet ist; sondern weil sie als normaler Mensch dem Heiland und Gottesssohn in jedem Fall weit, unendlich weit niedriger ist – und ihm deshalb keinesfalls das Wasser reichen kann.
Jemandem das Wasser reichen können oder auch nicht reichen können, bezeichnet in unserer Sprache eine Form der Gleichrangigkeit in Fähigkeit oder Stand oder eben der Ungleichrangigkeit, bezeichnet also ein Stück vertikaler Etikette, ein Kapitel Manieren des Oben und Unten: Dem kann ich nicht das Wasser reichen – der ist viel besser als ich.
Das geht auch ungefähr historisch in Ordnung, wenn doch diese Redensart: Jemandem das Wasser reichen können, ursprünglich wohl aus der höfischen Etikette mittelalterlicher Festtafeln stammt, die regelt, welcher Diener seinem Herrn das Reinigungswasser für die Hände reichen kann. Besteck gabs noch nicht, gegessen wurde mit den Fingern, also mit der Hand in den Mund. Heute ist das – kann man sagen: Gottseidank anders – wenn etwa beim Neujahrsempfang alle ganz manierlich Messer und Gabel benutzen und der anfallende Schmutz im Rahmen bleibt. Verständlich, dass dagegen die bestecklose Form der Nahrungsaufnahme die gelegentliche Reinigung der Hände erforderte, auch schon während der Mahlzeit; und zu diesem Zwecke war geregelt, wer das sei, der helfen darf: Wer wem das Wasser reichen kann.
Ursprünglich eignet unserer Redewendung damit keine egalitäre Bedeutung: ursprünglich, war der, der jemandem das Wasser reicht – reichen kann und reichen darf – immer noch bloß sein Diener. Das unterscheidet den ursprünglichen aber nur wenig von unserem heutigen Gebrauch, der doch auch unterschwellig, atmosphärisch eine Rangfolge meint, wenn mit leichter Herablassung „Der kann ihm nicht das Wasser reichen“ soviel wie „Der kann ihm noch nicht mal das Wasser reichen“ heißt.
Jesus jedenfalls hält sich keineswegs so lange wie wir mit diesen Fragen auf, sondern knüpft wie so oft an die relativ banale Alltagsfrage eine ungleich gewichtigere Frage des Glaubens an; Jesus verwandelt wie so oft Fragen der Etikette in solche der theologischen Ethik: Wie geht und was ist Leben, das vor Gott gilt – und deshalb „ewiges Leben“ genannt zu werden verdient?
Wenn das hier als Wassergeschichte, als Wer-wem-das-Wasser-reicht-Geschichte erzählt wird drängt sich die Taufe als Kontext auf. Das ist nach der Meinung der exegetischen Experten auch so gemeint vom Evangelisten Johannes, der sonst nicht von Taufe und Taufpraxis erzählt. So sind die Äußerungen Jesu an unserer Stelle als Taufpredigt zu verstehen. Verstehen wir sie?
Vor kurzem haben wir über die Taufe Jesu nachgedacht, wie sie erzählt wird und was sie uns bedeuten kann, und bemerkenswerter Weise wird auch jene Tauferzählung mit Fragen der Rangfolge verknüpft; auch da wird gefragt: Wer kann wem das Wasser, das Taufwasser reichen. Jesus begehrt von Johannes das Wasser der Taufe, Johannes weicht zurück – wie kann ich Dir das Wasser reichen? – Jesus besteht darauf – und er besteht darauf ohne wirkliche Begründung: um der Ordnung zu genügen, weil es sich so gehört, der Etikette wegen, weil Gott es so will; eigentlich weil er in der Taufe Jesu zeigen und verkünden will, dass dieser Jesus Gottes Sohn ist: „Das ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.“
Das Wasser der Taufe wird gereicht, damit durch das Symbol des Wassers die Verhältnisse zwischen Gott und Mensch geklärt werden, wobei: „Wasser tut‘ s freilich nicht, sondern das Wort Gottes, das mit und bei dem Wasser ist, und der Glaube, der solchem Worte Gottes im Wasser traut. Denn ohne Gottes Wort ist das Wasser schlicht Wasser und keine Taufe; aber mit dem Worte Gottes ist’s eine Taufe, das ist ein gnadenreiches Wasser des Lebens und ein Bad der neuen Geburt im Heiligen Geist; wie Paulus sagt zu Titus im dritten Kapitel: ´Gott macht uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unsern Heiland, damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unsrer Hoffnung´.“ (Luthers Kleiner Katechismus)
Mit „ewigem Leben“ ist nun aber keineswegs die endlose Fortsetzung unseres natürlichen Lebens gemeint, wie manchmal fälschlicherweise angenommen wird, auch um diesen Gedanken – eines endlosen Weiterlebens – als offenkundig absurd zurückzuweisen; oder – umgekehrt und noch falscher und absurder – ihn mit technischen Mitteln in die Tat umzusetzen. Gerade unter den Computer- und Hightec – Milliardären soll es angeblich Anhänger dieses teuren Aberglaubens geben, den sie mit ihren Milliarden umzusetzen versuchen. Was für eine Verschwendung an Geld und Hoffnung!
„Ewiges Leben“ heißt biblisch und im Gegensatz dazu das Leben vor Gott; also das Leben, dass die Engel führen; das Leben, in das uns die Taufe führt; das Leben, in dem wir uns als Gottes Kinder wissen; das Leben, in dem wir nicht nach immer neuem und mehr Leben hungern und dürsten müssen; das Leben, für das uns Gott alles reichlich gegeben hat; das Leben in Fülle. „Ewiges Leben“ ist das Leben vor Gott; das Leben in der Begegnung mit Gott.
Am Jakobsbrunnen, an dem sich Jesus das Wasser reichen lässt, wird an Jakobs Begegnungen mit Gott erinnert, an Momente, in denen Jakob Gott nah kam, indem Gott dem Jakob nahe, bisweilen gefährlich nahe kam; in jener Nacht des Kampfes mit dem Engel am Jabbok, eines Kampfes ohne Sieger, aber mit dem Segen für den Versehrten: „Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn“; oder jener anderen Nacht etwa, als ihm, dem Jakob, verlassen auf dem Feld von der Leiter und den Engeln darauf träumte; von den Engeln, die für uns und in Gottes Auftrag weite Wege gehen zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Mensch. Ihrem Auftrag gemäß vermitteln sie, überbrücken, teilen mit, segnen – und sind darin Boten des Ewigen Lebens.
Am Jakobsbrunnen lässt sich Jesus das Wasser für uns reichen, damit wir Gott begegnen. Tief ist dieser Brunnen, unergründlich ist er zu nennen, aber es ist nicht der Brunnen der Vergangenheit, sondern der Ewigkeit. Nicht zurück soll unser Blick gehen, sondern nach oben. Es geht nicht darum, in die alten Geschichten zu tauchen. Religion ist nicht Archäologie, das Klopfen toter Steine; allerdings auch nicht Zukunftsforschung, geschweige denn Demoskopie, das Zählen ungelebter Leben; sondern Anleitung zur Erfahrung der Gegenwart Gottes – „der unmittelbaren Gegenwart des ganzen ungeteilten Daseins“ – des Ewigen Leben. Das will uns Jesus reichlich reichen.