
Feier der Osternacht am 20. April 2025 (Bilder)

Wiesbaden

Die Skulpturensammlung des Frankfurter Städel im Liebieghaus am Schaumainkai war das Ziel des ökumenischen Ausflugs mit unseren katholischen Nachbarn von St. Mauritius am 27. März 2025. Durch die Mittelalter-Sammlung führte Frau Reith-Deigert. Die Kunsthistorikerin vermittelte uns zu ausgewählten Sammlungsstücken den jeweiligen Hintergrund und machte uns auf eine Fülle interessanter Details und Querverbindungen aufmerksam. Besonders intensiv konnten wir den Rimini-Altar aus Alabaster von 1430 als Hauptstück der Sammlung betrachten.




(Fotos: privat)




(Fotos: Ev. Dekanat 2023)
Am Sonntag, 18. Mai 2025, um 11.00 Uhr lädt das Evangelische Dekanat Wiesbaden Täuflinge und ihre Familien aus allen evangelischen Gemeinden zum Tauffest, einer großen Open Air-Veranstaltung im vorderen Teil des Kurparks ein. Es beginnt mit einem kurzen Gottesdienst. Im Anschluss werden Pfarrerinnen und Pfarrer des Dekanats an mehreren Taufstationen rund um den Teich taufen. Danach kann im Kurpark gepicknickt werden.
Es gibt viele gute Gründe zur Taufe. Wenn Sie mehr dazu wissen möchten, schauen Sie gerne unter Tauffest 2025-Dekanat Wiesbaden, oder melden Sie sich unter Tel. 0611 734242-10, tauffest-wiesbaden@ekhn.de. Die Anmeldung zum Tauffest ist bis Dienstag, 22.4., möglich.
HERR, du hast mich überredet, und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen; aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich, und jedermann verlacht mich.
Denn sooft ich rede, muss ich schreien; »Frevel und Gewalt!« muss ich rufen. Denn des HERRN Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich.
Da dachte ich: Ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich’s nicht ertragen konnte; ich wäre schier vergangen.
Denn ich höre, wie viele heimlich reden: »Schrecken ist um und um!« »Verklagt ihn!« »Wir wollen ihn verklagen!« Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle: »Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen.«
Aber der HERR ist bei mir wie ein starker Held, darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. (Buch des Propheten Jeremia 20)
Liebe Gemeinde,
von der Last des prophetischen Amtes ist hier beim Propheten Jeremias die Rede – und soll also heute die Rede sein. Von den Widrigkeiten der öffentlichen Wortverkündigung, von den Widerständen, die ein Knecht Gottes erfährt. So schwer kann die Last werden, dass die Füße nicht mehr gehen wollen, die Stimme bricht, der Rücken sich krümmt. Das Amt zu schwer wird – vielleicht von Anfang an zu schwer war.
In diesem Jahr 2025, erinnern wir uns an ein Geschehen vor 500 Jahren, wenn ich richtig rechne also 1525, das trotz mancher Versuche der Umbenennung immer noch Bauernkrieg heißt, und aus guten Gründen so heißt: Bauernkrieg. In diesem – noch aus der zeitlichen Ferne vielfach herzzerreißenden Geschehen von Aufruhr und Unterdrückung, Gewalt und Gegengewalt, von ungeheuren Opfern, von 100.000 Toten ist zu reden; erheben auch Geistliche, Diener Gottes, Propheten die Stimme; besonders laut, bisweilen schrill Thomas Müntzer.
„Darum seid getrost und tut Gott den Dienst und vertilget diese untüchtige Oberkeit. Dann was hilfts, ob wir schon Frieden machten mit ihnen, denn sie wollen doch fortfahren, uns nicht freilassen, treiben uns zu Abgötterei. Nun seind wir schuldig, lieber zu sterben, denn in ihr Abgötterei zu verwilligen. Es were je besser, daß wir Merterer wurden, dann daß wir leiden, daß uns das Evangelium entzogen werd und wir zu der Pfaffen Mißbrauche gedrungen werden. Darüber weiß ich gewißlich, daß Gott uns helfen würd und uns Sieg geben, denn er hat mir mündlich solches zugesagt und befohlen, daß ich alle Stend soll reformieren. …
Laßt euch nicht erschrecken das schwach Fleisch und greift die Feind kühnlich an, dörft das Geschütz nit förchten, dann ihr sollt sehen, daß ich alle Büchsenstein in Ärmel fassen will, die sie gegen uns schießen. Ja ihr sehent, daß Gott auf unser Seiten ist, denn er gibt uns jetzund ein Zeichen. Sehent ihr nicht den Regenbogen am Himmel? Der bedeut, daß Gott uns, die wir den Regenbogen im Banner führen, helfen will und dreuet den mördrischen Fürsten Gericht und Strafe. Darum seind unerschrocken und tröstet euch göttlicher Hilf und stellt euch zu Wehre. Es will Gott nicht, daß ihr Fried mit den gottlosen Fürsten machet.“ (Letzte Predigt Müntzers vor der Schlacht bei Frankenhausen 15. Mai 1525)
Thomas Müntzer von Allstedt am Harz, Reformator der ersten Stunde, Wegbereiter der evangelischen Lehre, Autor der ersten Gottesdienstordnung in deutscher Sprache, Dichter geistlicher Lieder, deren einziges, das noch im Gesangbuch steht, wir heute gesungen haben; aber auch unruhiger mit unstetem Leben, Wanderer am – wie er es sah – Ende der Zeiten, Getriebener des Geistes, wobei nicht immer klar war, ob das ein heiliger war; Vertriebener aus eigentlich allen Orten und Ämtern und am Ende, nachdem er durch seine letzte, fanatische Predigt die Aufständischen in Frankenhausen in Schlacht und Tod gesendet hat, selbst grausam gefoltert und ermordet durch die Knechte der Fürsten; Opfer seines Eifers, der Verhältnisse, der grausamen Rache einer unbarmherzigen Obrigkeit; durch das Schwert umgekommen, das er selbst in die Hand genommen hat.
An ihm, dem Propheten, der sich verlaufen hat, wird in völlig übertriebener, geradezu karikaturhafter Weise sichtbar und unübersehbar deutlich, was das ist, ein geistliches Amt;
was er zu tragen hat: ein Gottesmann; was er auszuhalten genötigt wird als Stimme Gottes. Viel mehr jedenfalls, als jemand, als ein Mensch aushalten und tragen kann. Und das nicht nur wegen der unerträglichen Verzerrung des Amtes, die er selbst vollzieht; sondern weil das geistliche Amt immer schon und von sich eine Überforderung, eine Überdehnung, eine Verzerrung in sich trägt; strukturell sozusagen, unausweichlich; das gehört zum Amt dazu. Denn: als gottloser Sünder soll ich Gott verkündigen; aus jenseitiger Ferne von Gottes Nähe sprechen; als Mensch Gott loben. Wie soll das gehen?
Ich, gottloser Sünder, will Gott loben: Das formuliert den Auftrag und zugleich den Zwiespalt des geistlichen Amtes, von dem auch Jeremias spricht und unter dem er leidet. Von der Gottlosigkeit der Menschen, seiner selbst natürlich auch, und der Gottheit Gottes soll er sprechen. Das Prophetenamt benennt eine unmögliche Möglichkeit. Wie könnte er daran nicht zerbrechen?
Von keinem anderen Propheten überliefert die Bibel eine so ergreifende Leidensgeschichte. Weich wie grüner Weizen fühlt sich Jeremia seiner frühen Berufung nicht gewachsen. Der prophetische Auftrag quält Jeremia und macht sein Herz krank. Was Gott ihm zumutet, empfindet Jeremia als bewusste Täuschung. Jeremia muss Israel den Untergang verkündigen und darf noch nicht einmal beten für sein Volk. Dafür wird Jeremia gehasst, verfolgt, eingesperrt, gefoltert, tödlich bedroht. Etwa 40 Jahre ist Jeremia mit Worten, Schrift, Aktionen und seiner gesamten Existenz der Mund Gottes. Dabei lässt Jeremia auch seine eigene Stimme, sein heulen hören. Eindrücklich ist sein inneres und äußeres Leiden dokumentiert. In direkter Fortsetzung unseres Predigttextes klagt Jeremia sein Leid, verflucht sein Leben:
Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin; der Tag soll ungesegnet sein, an dem mich meine Mutter geboren hat!
Verflucht sei, der meinem Vater gute Botschaft brachte und sprach: »Du hast einen Sohn«, so daß er ihn fröhlich machte!
Der Tag soll sein wie die Städte, die der HERR vernichtet hat ohne Erbarmen. Am Morgen soll er Wehklage hören und am Mittag Kriegsgeschrei,
weil er mich nicht getötet hat im Mutterleibe, so daß meine Mutter mein Grab geworden und ihr Leib ewig schwanger geblieben wäre!
Warum bin ich doch aus dem Mutterleib hervorgekommen, wenn ich nur Jammer und Herzeleid sehen muß und meine Tage in Schmach zubringe!
Auch in Jeremia, seinem beinahe nihilistischen Ausbruch zeigt sich – übertreibend, vergrößernd und vergröbernd – der Riss, der Zwiespalt dessen, der Gott verkündigt: Ich, gottloser Sünder, will Gott loben. Wie soll das gehen?
Es geht nicht von mir aus, nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigener Macht und Herrlichkeit. Kein Prophet kann selbst für seine Worte einstehen. Kein Prophetisches Leben die eigene Lehre beglaubigen. Wir können unsere Botschaft nicht durch uns selbst, nicht durch unser eigenes Leben wahr machen, nicht durch ein gottgefälliges Leben – und Gott sei dank, auch nicht unwahr machen durch unsere Verfehlungen. Nur Gott selbst kann unsere Worte beglaubigen, sie wahr machen. Nur Gott selbst kann den Riss heilen, den Zwiespalt, den garstigen Graben zwischen dem gottlosen Sünder und seinem heiligen Wort überbrücken.
Damit bleibt das prophetische Projekt notwendig unabgeschlossen; auch 40 Jahre Dienst im Auftrag des Herrn reichen nicht; Jeremia und seine Prophetengenossen können ihr Werk nicht vollenden, in alle Ewigkeit nicht. Aber sie können sagen und darauf hinweisen, was uns Menschen zum vollständig sein fehlt. Sie können ausrufen und deutlich machen, was uns heil macht. Sie können in Worten und Taten erklären, wer uns heiligt, ohne uns dabei zu Heiligen zu machen: Gott selbst nämlich, der zu uns kommt, der unser Leben und unser Leiden teilt, der sich selbst unter die verfolgten Propheten reiht.
Wenn die Propheten das hinbekommen, dass sie nicht sich selbst lehren, sondern den, der sie beauftragt, bekommt ihr schwieriges Geschäft einen Sinn. Wenn sie von sich selbst weg und auf Gott hinweisen. Wenn ihre Fehlbarkeit und ihre Sündhaftigkeit also kein Makel, sondern geradezu notwendige Bedingung ihrer Botschaft ist. Nicht ich bin der starke Held – sondern wie Jeremias sagt: der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Nicht um mich geht es – sondern um den, von dem ich spreche. Nicht um meine angeblich bessere Gerechtigkeit, sondern allein um die gerechtmachende Gerechtigkeit Gottes. Mein Ungenügen ist die glückliche Schuld, die den Glauben an den Gott stiftet, der den Gottlosen aufhebt und zu sich nimmt. Kyrie Eleison – Herr erbarme dich – das ist der Ruf des begnadeten, gerechtfertigten Sünders.
Uns aber bleibt die prophetische Botschaft, dass nicht meine Schwäche zählt, sondern Gottes Stärke mein Leben heil macht: Der HERR ist bei mir wie ein starker Held. Amen.
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.

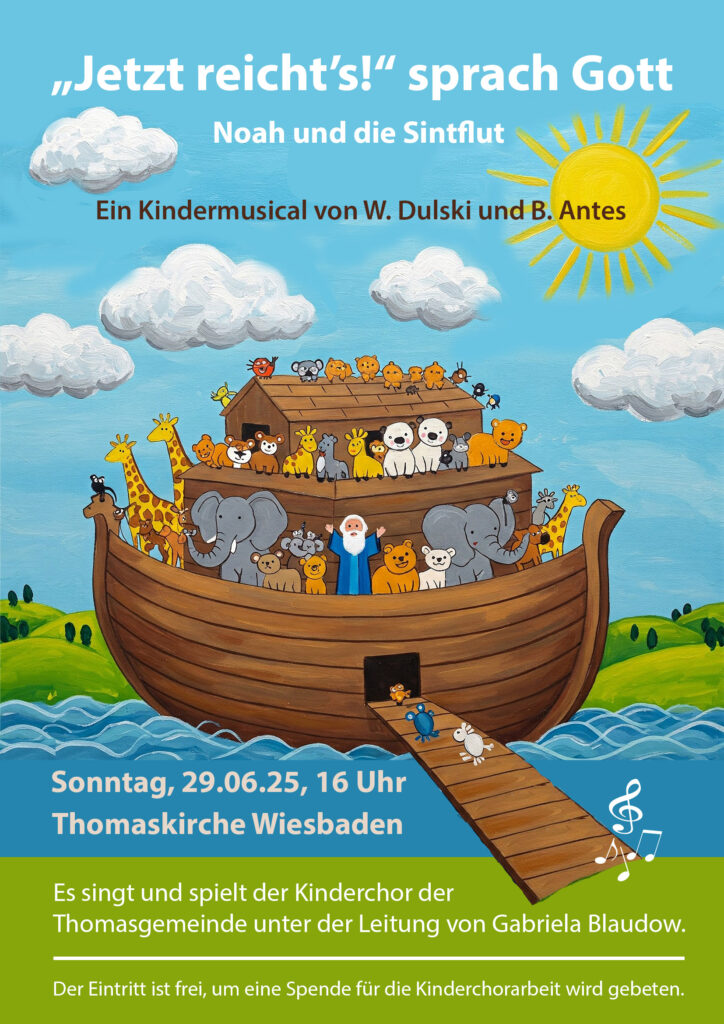
Donnerstag, 27. März 2025, 18.15-19.15 Uhr
Ev. Thomasgemeinde und Kath. Kirchort St. Mauritius

Der Rimini-Altar zählt zu den größten und herausragendsten Alabaster-Ensembles Europas und bildet seit 1913 das Glanzstück der Mittelalter-Abteilung des Liebieghauses, der Skulpturensammlung des Frankfurter Städels. Die einstündige Führung durch die Mittelalter-Sammlung beginnt um 18.15 Uhr. Im Anschluss ist noch Zeit, sich in dieser Gründerzeitvilla am Schaumainkai die weiteren Schätze – Skulpturen aus Marmor, Holz, Terracotta, Bronze und Elfenbein von der Antike bis zum Klassizismus – anzuschauen.
Die Anreise erfolgt privat, z.B. mit der S-Bahn bis Frankfurt Hauptbahnhof und ca. 20 Minuten zu Fuß über den Holbeinsteg zum Museumsufer. Die Führung selbst ist für die Teilnehmenden kostenlos. Der Museumseintritt kostet 8 Euro.
Vor der Führung treffen wir uns, wer mag, um 17.00 Uhr im Café des Liebieghauses.
Da die Teilnehmerzahl auf 25 Personen begrenzt ist, bitten wir Sie um Ihre Anmeldung unter asmeine@gmx.de oder Tel. 0162 7474131.
https://www.liebieghaus.de/de/mittelalter
(Foto: Wikipedia)
Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht: Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Makedonien und hilf uns! Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen.
Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Makedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen.
Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu; der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf achthatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns.
(Apostelgeschichte 16,9-14)
Mit meinen Schülerinnen und Schülern der 7. Klasse erarbeiten wir uns gerade die Anfänge des Christentums: Wie und auf welchen Wegen hat sich der christliche Glauben ausgebreitet und warum hat er sich schließlich durchgesetzt? Wie kommt es vor ziemlich genau 1700 Jahren zum Konstantinischen Zeitalter, das nun womöglich nach 1700 Jahren gerade allmählich zu Ende geht? Und wie gelangte der christliche Glauben zu uns nach Germanien jenseits des Rheins knapp vor dem Limes, an die Grenze der römischen, ach sagen wir gleich: an die Grenze der zivilisierten Welt?
Und weil Umwege nicht nur beim Predigen, sondern auch im Unterricht die interessantesten Wege sind, haben wir uns zumindest in Gedanken und mit Bildern erstmal in das römische Wiesbaden, das römische Frankfurt und das römische Mainz versetzt, um insbesondere die Religion zu kennenzulernen, auf die die christliche Religion stieß und die sie überraschenderweise verdrängte. An wen und was haben die Menschen geglaubt, die kurze Zeit später an Jesus Christus glaubten, haben wir uns gefragt. Nämlich an Jupiter und Juno, an Merkur und Vulkan, an Diana und Apollo, an Sol invictus und Mithras; und besonders in Wiesbaden an die Götter von Heil und Heilung, wie neben Diana Matthiaca und Apollo Toutiorix die romanisierte keltische Göttin Sirona, die an der Schützenhofquelle verehrt wurde, gegenüber von Aldi; noch heute wärmen sich die Obdachlosen unter ihrem Graffiti an der ihr geweihten heißen Quelle.
Zusammen mit diesen römischen und römisch verehrten Gottheiten fanden sich bisher keine Spuren des christlichen Glaubens bei uns aus derselben Zeit, bis kürzlich – bis kürzlich – in einem Gräberfeld in Frankfurt ein sensationeller Fund gemacht wurde, ein offensichtlich christlicher Text aus römischer Zeit in germanischer Erde.
„(Im Namen?) des Heiligen Titus.
Heilig, heilig, heilig!
Im Namen Jesus Christi, Gottes Sohn!
Der Herr der Welt
widersetzt sich nach [Kräften?]
allen Anfällen(?)/Rückschlägen(?).
Der Gott(?) gewährt dem Wohlbefinden
Eintritt.
Dieses Rettungsmittel(?) schütze
den Menschen, der sich
hingibt dem Willen
des Herrn Jesus Christus, Gottes Sohn,
da sich ja vor Jesus Christus
alle Knie beugen: die Himmlischen,
die Irdischen und
die Unterirdischen, und jede Zunge
bekenne sich (zu Jesus Christus).“
Das „Rettungsmittel“, von dem der kurze Text spricht, ist eine kleine Kapsel, kleiner als der kleine Finger, kürzer und dünner; eine Kapsel, in der eine entsprechend kleine Folie aus Silberblech gerollt war mit dem gerade verlesenen Text eines Gebets oder einer Beschwörungsformel. Nachdem sie vor ein paar Jahren im heutigen Frankfurt-Praunheim, dem römischen Nida, dem deutschen Pompeji, gefunden und aufwändig bearbeitet wurde, liegt sie mittlerweile in einer Vitrine, eher grau als silbern in einer Vitrine, ganz und gar unscheinbar im Archäologischen Museum in Frankfurt, das sonst nicht mit Sensationen glänzt.
Dieses Silberröllchen aber ist eine Sensation – manchen gelehrten Einwürfen zum Trotz – , in dem es das früheste Zeugnis des christlichen Glaubens abgibt nördlich der Alpen. Durch seinen Fundort in einem Grab lässt es sich ziemlich genau auf die Jahre 230-260 nach Christus datieren. Es markiert eine Zwischenstation zweihundert Jahre nach dem Wirken des Apostel Paulus, von dem wir heute hören, bis zum endgültigen Sieg des Christentums im römischen Reich, der Konstantinischen Wende, abermals 100 Jahre später.
Mit diesem Silberröllchen sehen wir, wie das christliche Abendland im Gebiet des heutigen Deutschland begann. So wie wir im Predigttext hören, wie Paulus den christlichen Glauben nach Europa trug. Dass sich hier Unterschiede zeigen, ist zu erwarten, ist selbstverständlich. Die Inschrift eines Amuletts als Grabbeigabe benennt notwendigerweise anderes als der Reisebericht über einen Apostel oder dieser selbst in seinen Briefen. Interessanter, überraschender, ja sensationeller sind für mich die Gemeinsamkeiten und Berührungspunkte. Wenn sich nämlich im Grab einer Soldatensiedlung an der äußersten Grenze des Römischen Reiches, dem Limes, zweihundert Jahre nach dem Wirken des Apostel Paulus Anspielungen von erstaunlicher Eindeutigkeit finden:
Offensichtlich wissen wir von dem weiten Weg des christlichen Glaubens in den ersten Jahrhunderten nur Anfang und Ziel, also vom Anfang bei den Jüngern Jesu und vom Ziel, der Anerkennung des Christentums durch Kaiser und Reich. Dazwischen liegen verschlungene Wege, Umwege bestimmt auch, weite Wege bis an die Grenzen des Reiches, bis an die „Enden der Erde“, wie es in der Apostelgeschichte gelegentlich heißt. Bis an den Limes gleich hinter Hoher Wurzel und Platte ist das Wort des Glaubens jedenfalls gekommen.
Trotz aller Bemühungen, den Gang des Wortes zu steuern und den Glauben zu definieren, wie etwa auf dem berühmten Konzil von Nizäa im Jahr 325, also vor genau 1700 Jahren, erstreckt sich eine Vielfalt christlicher Wege und Glaubensweisen, damals wie heute. Der Schreiber und Träger des Amuletts aus Praunheim drückt seinen Glauben anders aus als ein Schüler heute oder als ein Lehrer heute oder als ein Professor heute; aber diese wiederum anders als die versammelten Bischöfe in Nizäa oder etwa ein irischer Mönch, der nach hunderten von Jahren, in denen hier in dieser Gegend der Glaube in Vergessenheit geriet, ihn neu entfachen konnte; aber diese wiederum anders als der mächtige Erzbischof von Mainz oder sein Gegenspieler, der Reformator Martin Luther von jenseits der Elbe, der auch mal über den Rhein und durch Frankfurt kam; aber beide anders als die immer noch vielen Glaubenden heutzutage, wenn der christliche Glauben nicht mehr Mehrheitsreligion ist in unserer Gegend und das Konstantinische Zeitalter bei uns zu einem Ende gekommen zu sein scheint – während an vielen anderen Orten der Welt der christliche Glauben immer noch wächst.
Alle so unterschiedlich Glaubenden aber, die Genannten und viel mehr Ungenannte, beziehen sich auf je eigene, höchstpersönliche Weise auf das Wort Gottes, auf Jesus Christus, Gottes Sohn, als ihren Maßstab und Referenzpunkt, ihre Sonne und Licht, ihren Weg, ihre Wahrheit und ihr Leben. Sie sind angetrieben – wir sind das – von dieser Gewissheit, die schon Paulus aus Asien nach Europa brachte, von der wir heute hören: gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Und wir sind darauf angewiesen, über dieses Wort ins Gespräch zu kommen, uns gegenseitig in Vielfalt und Einheit des Glaubens wahrzunehmen: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da.
Damit ist übrigens auch eine vorläufige Antwort auf die Frage angedeutet, wie und warum sich der christliche Glauben gegen die religiöse Konkurrenz durchsetzen konnte: Kommt in mein Haus und bleibt da. Sozialer Zusammenhalt, gegenseitige Hilfe, persönliche Bindungen, Nächstenliebe – das waren nach Meinung der Gelehrten die entscheidenden Unterschiede zu anderen Kulten in der römischen Antike, die das Christentum erfolgreich machten. Amen.
Ökumenischer Ausflug mit St. Mauritius nach Taunusstein am 14.2.25: Beim Rundgang durch die Werkstätten und die Galerie erläuterte uns Gesellin Leandra die Details der verschiedenen Glasverarbeitung und -veredelungstechniken, gab sachkundig Antwort auf alle Fragen und zeigte uns die erstaunliche Vielfalt zeitgenössischer Glaskunst.



(Bild 2: Kunstwerk von Mark Angus; Fotos: privat;)