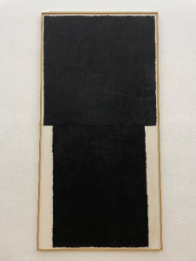Und Josua sprach zum Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Und Josua sprach zu den Priestern: Hebt die Bundeslade auf und geht vor dem Volk her! Da hoben sie die Bundeslade auf und gingen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua: Heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel, damit sie wissen: Wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Und du gebiete den Priestern, die die Bundeslade tragen, und sprich: Wenn ihr an das Wasser des Jordans herankommt, so bleibt im Jordan stehen. …
Siehe, die Lade des Bundes des Herrn der ganzen Erde wird vor euch hergehen in den Jordan. So nehmt nun zwölf Männer aus den Stämmen Israels, aus jedem Stamm einen. Wenn dann die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn, des Herrn der ganzen Erde, tragen, in dem Wasser des Jordans stillstehen, so wird das Wasser des Jordans, das von oben herabfließt, nicht weiterlaufen, sondern stehen bleiben wie ein einziger Wall. …
Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen still im Trockenen mitten im Jordan. Und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. (Josua 3, 5-8.11-13.17)
Das Mitführen eines sperrigen, schweren Kastens auf langen Reisen durch Wüste und Wasser muss uns nicht unmittelbar einleuchten; aber dass selbst der, der gerne mit leichtem Gepäck reist, das Nötigste dabeihaben will und muss, leuchtet sehr wohl ein. Entscheidend ist natürlich die Definition des „Nötigsten“, über die nicht ohne Weiteres Einigung zu erzielen ist: „Muss das jetzt wirklich alles mit, Liebste?“. Manchmal schon und manchmal muss es eine Bundeslade sein.
In der privaten Mythologie meiner Familie bezeichnete Bundeslade die Reisehandtasche meiner Mutter. In diese Bundeslade, eine Handtasche von nicht geringem Ausmaß, verstaute sie alles Wichtige für eine Reise: Zahlungsmittel ob Geld oder Reisechecks, Pässe, Gesundheitsausweise, Versicherungspolicen, Hotelunterlagen, Reiseführer; also alles, was heute im vergleichsweise winzigen Smartphone geborgen und auf Tastendruck vorgelegt werden kann; was damals aber ein beträchtliches Taschenvolumen erforderte. Diese Tasche verlangte Aufmerksamkeit und Schutz – „Wo ist die Bundeslade?“ Ihre Trägerin war nicht einfach nur die Reiseleiterin, sondern ihre teure Last verlieh ihr einen besonderen, quasi auratischen Status. Die Bundeslade öffnete Türen, ebnete Wege, ermöglichte Weiterfahrt und glückliche Wiederkehr. Wurde sie bewahrt, waren wir bewahrt. Wenn sie verloren ginge, wäre alles verloren.
Diese Metapher war keinesfalls respektlos gemeint, sondern traf ziemlich gut, was es mit der Bundeslade der Israeliten auf sich hatte, sozusagen ihre Funktion als Garantie der Reise, Wegbereiter, Türöffner durch ihren wertvollen – natürlich ungleich wertvolleren – Inhalt: hier nun der Zehn Gebote, des Wortes Gottes, Gottes selbst. Gott begleitet sein Volk auf seiner Reise durch die Wüste in das gelobte Land in Gestalt der echten, einzigen und originalen Bundeslade. In ihr und aus ihr heraus „geschieht“ das Wort Gottes – wie es in der biblischen Sprechweise heißt, als wirkmächtiges, machtvolles Wort. Es begleitet und beschützt sein Volk in dem Maße, dass dieses sich durch das Wort schützen lässt. Solange und in dem Maße Israel seinem Gott glaubt, sein Wort hört, seine Gebote bewahrt, an ihn sein Herz hängt, begleitet und beschützt Gott sein Volk. Insofern verleiht Gott selbst dieser Lade eine Aura, ist Gott selbst in dieser Lade anwesend.
„Woran du dein Herz hängst“ – sagt Luther – „das ist dein Gott“. Für die Israeliten erfüllte das – solange es keinen festen Ort, keinen Tempel Gottes gab – die Bundeslade, die als mobiles, als ambulantes, als Reiseheiligtum mitgeführt werden konnte.
Anders als heute, waren Reisen in alter Zeit kein Vergnügen, keine Erholung, nicht Ausdruck von Neugier, sondern Folge von Not, von Wirtschaftsflucht, von Krieg – oder im besonderen Fall des Volkes Israel eben auch gottgewollt und Funktion seiner Religion: Aufbruch und Wanderung, Weg und Ankunft – gehören sozusagen zur DNA dieser Religion. Wandernd erschließt sich ihr Gott. Der Weg ist das Ziel. Aber auch Ausgangs- und Ankunftspunkte haben Bedeutung. Der Jordan bezeichnet gewissermaßen die Ziellinie eines Laufs, der am Schilfmeer begann.
Genau betrachtet spiegelt sich sogar hier im Jordan das Schilfmeer, ist diese Geschichte hier vom Durchzug durch den Jordan der Rettung aus dem Schilfmeer nachgebildet – bis in Motive und Begriffe hinein: Das Wasser des Jordans, das von oben herabfließt, wird nicht weiterlaufen, sondern stehen bleiben wie ein einziger Wall. …Und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war.
Genauso war es am Beginn der großen Reise, als das Volk Israel trockenen Fußes durchs Meer schritt in die Freiheit. Zwischen Schilfmeer und Jordan liegen vierzig Jahre, Wanderung durch die Wüste, Prüfung und Reifung, Entbehrung und Bewährung, Begleitung durch Gott, sichtbar in Gestalt der Bundeslade als Ort seiner machtvollen Gegenwart. Gegenwärtig auch hier am Ziel, das vorläufig bleibt; hier und jetzt gegenwärtig jedenfalls in, mit und durch die Bundeslade, die den Wasserfluss staut und die sichere Passage ermöglicht: Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen still im Trockenen mitten im Jordan. Und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war.
Bleibt eigentlich nur die Frage, warum wir ausgerechnet heute – am ersten Sonntag nach Epiphanias, in der allmählich ausklingenden Weihnachtszeit – eingeladen sind, ausgerechnet über diese Erzählung eines so überaus bedeutenden Ereignisses aus der Geschichte Israels nachzudenken; einer Geschichte, die wir uns ja ohnehin immer zu eigen, zu unserer eigenen Geschichte machen und in unsere Lebensgeschichte hineinschreiben sollen.
Zum einen geht es natürlich an Epiphanias um die Gegenwart Gottes und die verschiedenen Weisen dieser Gegenwart, wie sie sich ereignet und zeigt. Hier also als heiliges Gepäck (nicht Gebäck, wobei das auch richtig sein kann!), als das unverzichtbar Heil- und Sinnstiftende, das wir immer mitzuführen haben, als das, womit uns Gott auf unserer Reise durch das Leben begleitet: Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Wer sind wir? Gottes geliebte Kinder auf dem Weg von Gott zu Gott.
Das aber – dass wir Gottes geliebte Kinder auf dem Weg von Gott zu Gott sind – wird – zum anderen – nirgendwo so deutlich wie im Geschehen der Taufe und unserer Erinnerung daran, unserem Taufbewusstsein: „Ich bin getauft“ schreit Luther dem Teufel entgegen, weil er nicht dem Teufel sondern zu Gott gehört durch die Taufe.
Deren „Urort“ und Originalschauplatz ist der Jordan. Mit seinem Wasser werden wir getauft, auch wenn unser Taufwasser aus der Leitung in Wiesbaden kommt. Wie dort am Jordan die Israeliten sind wir durch Gott beschützt vor den Todesfluten, die uns zu ersäufen drohen. Gottes Bundeslade ist die Arche, die uns bewahrt, damit wir nicht verloren gehen. Von Gott haben wir das Gepäck, das nicht wir tragen, sondern dass uns durch das Leben trägt.