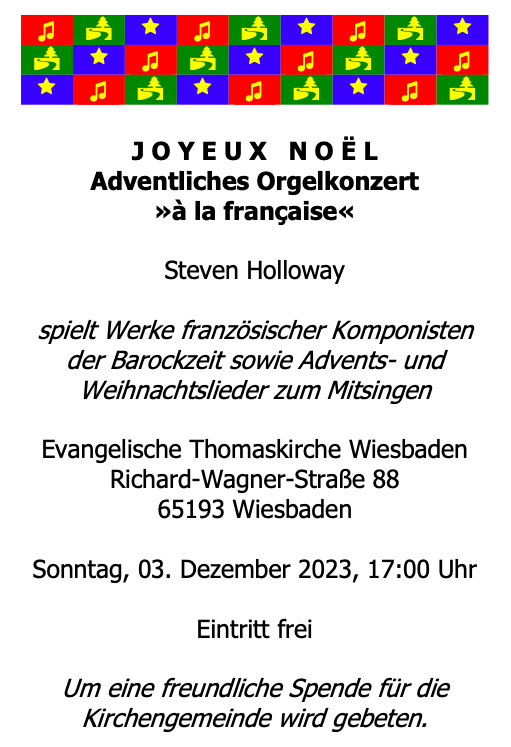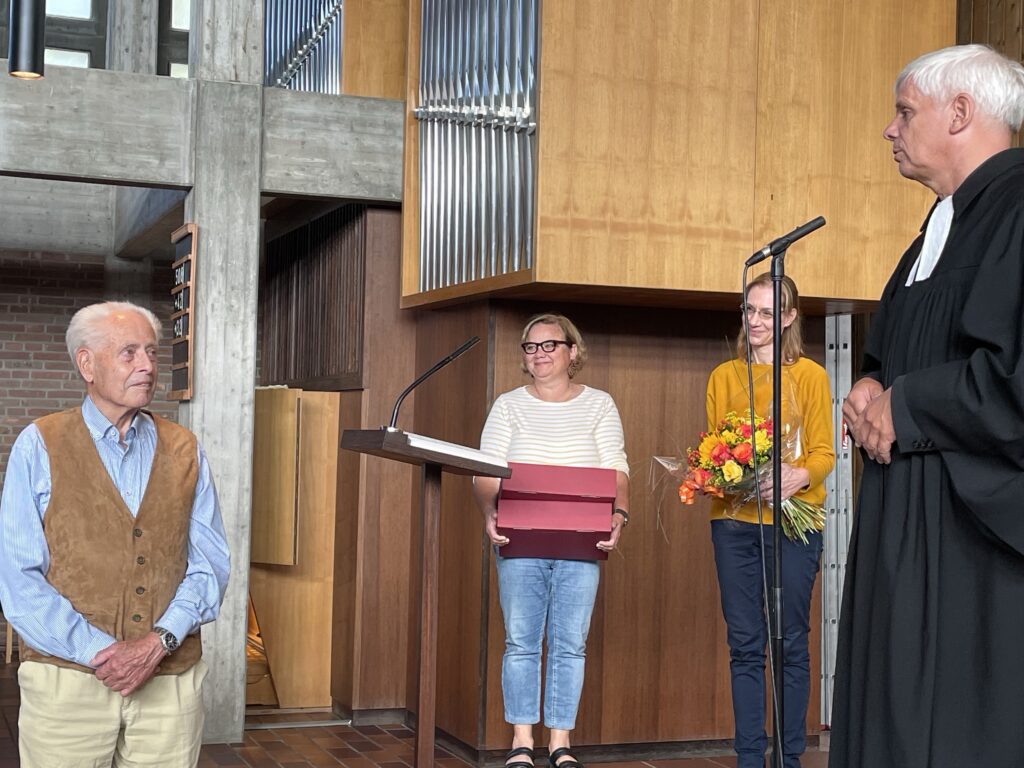Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit, und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt!
Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln! Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht.Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr nicht getan habt einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen: diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. (Matthäus 25,31-46)
All lives matter; jedes menschliche Leben zählt; alle Leben sind wichtig.
Es ist diese Botschaft, die von der gewaltigen Bühne des Weltgerichts heute zu uns gesprochen wird; von einer Bühne, die mit ihren Requisiten und Bildern von Himmel und Hölle, vom Teufel und Engeln, mit ihrer Massenszene aller je gelebten Menschen – das kann voll werden – und mit den machtvollsten Protagonisten, die Menschen glauben können, Gott selbst und seinem Sohn: von einer Bühne also, die unsere religiöse Vorstellungskraft beansprucht und herausfordert wie keine andere, von dieser Bühne wird heute zu uns gesprochen, dass alles Leben wichtig ist, jedes menschliche Leben zählt: All lives matter.
Und zwar sind unserer aller menschlichen Leben Gott so wichtig, dass mit unserem Lebensende nicht einfach die Akten geschlossen werden, so unabgeschlossen und unabgegolten unsere Aktionen gewesen sein mögen, sondern dass sie von Gott wiederaufgenommen werden, dass er sie sich ein letztes und letztgültiges Mal noch einmal vorlegt. Nichts bleibt vergessen, nichts fällt unter den Tisch. Damit verwirklicht Gott eine Gerechtigkeit, die vor unseren Gerichten – und sei es am Ende eines langen Instanzenweges – unmöglich bleibt. Vollständige und umfassende Gerechtigkeit für alle und jeden kann es nur bei Gott geben: All lives matter, alle Leben zählen.
Kein gnädiges – und schon gar kein ungnädiges, also etwa gedankenloses, erschöpftes, unwilliges – Vergessen steht am Ende aller Zeiten und Tage, sondern vollständige, umfassende und gerechte Erinnerung als dem Geheimnis der Erlösung. Kein unterschiedsloses Zudecken mit Gnade und Begraben von Schuld steht am Ende, sondern die wahrhafte Suche, lückenlose Aufklärung, genaue Benennung: die Wahrheit als Voraussetzung von Gerechtigkeit. Kein Gericht und kein gesellschaftlicher Prozess der Aufarbeitung und Widergutmachung nach Gewaltherrschaft und Krieg kann das leisten, auch wenn sie in ihren besten Momenten diesem Ideal folgen oder doch jederzeit mit aller Kraft folgen sollten – ohne es zu erreichen. Dennoch – trotz und wegen unseres Unvermögens zu Wahrheit und Gerechtigkeit – hebt Gott unser Vergessen in seiner Erinnerung auf. Das ist das Weltgericht.
Das ist das Weltgericht, von dessen zweifachem Ausgang nicht erzählt wird, um Angst zu verbreiten, sondern um Angst zu nehmen; oder anders gesagt: von dem erzählt wird, um den Angstmachern Angst zu machen und den Ängstlichen sie zu nehmen, und damit beiden erst gerecht zu werden. Ein gerechtes Urteil kann ja nicht darin bestehen allen dasselbe zukommen zu lassen; Übeltätern und Wohltätern, Tätern und Opfern allen dasselbe. Gerechtigkeit muss Unterschiede machen. Ein gerechtes Urteil vor Gericht kann ebenso wenig wie ein um Gerechtigkeit bemühter Kommentar angesichts von Konflikten und Kriegen einfach neutral von Leid auf allen Seiten sprechen. Auch Täter können leiden und Opfer können Leid zufügen, ohne damit ein Schuldgleichgewicht herbeizuführen. Das Saldieren von Leid verdirbt die historische Buchführung.
Deshalb kann das wahre Wort – all lives matter, alle Leben zählen – zur konkreten Lüge werden, wenn es nämlich das konkrete Leid der Opfer und die konkrete Schuld der Täter überdecken soll. Black lives matter – behauptet ja nicht, dass nicht alle Menschenleben wichtig wären, sondern im Gegenteil: Weil alle Leben zählen, zählen eben auch schwarze Leben, was angesichts von schwarzem Leid und weißer Schuld aber ausdrücklich benannt werden muss. Jewish lives matter – behauptet ja nicht, dass nicht auch christliche oder muslimische, nicht auch deutsche oder palästinensische Leben wichtig wären, sondern im Gegenteil: Weil alle Leben zählen, zählen eben auch jüdische Leben, was angesichts von historischem und aktuellem Leid von Juden ausdrücklich und laut gesagt werden muss. In der konkreten Notlage kann ich nur so der allgemeinen Wahrheit – all lives matter – gerecht werden; anders wird sie angesichts eines Terrorangriffs einer Gruppe auf ein Land zur zynischen Lüge. Natürlich zählen die Menschen in Oberbayern und auf den Fidschi-Inseln – aber angesichts eines Gewaltaktes im jüdischen Israel muss das nicht extra gesagt werden. Das andere schon: Jüdische Leben zählen, jetzt!
Gerechtigkeit lebt von Genauigkeit. Gerechtigkeit erweist sich in Notlagen und gegenüber Notleidenden. Gerecht ist nicht zuerst der, der den allgemeinen Weltfrieden predigt, sondern der, der genau diesen Krieg bekämpft und genau jenen Frieden bereitet. Gerecht ist nicht zuerst der, der allen Essen und allen zu trinken gibt, sondern der, der den Hungrigen Essen und den Durstigen zu trinken gibt. Unser Gerichtsgleichnis lässt den richtenden König sagen: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Es ist die in der hebräischen Sprache „Gerechtigkeitstat“ – Zedaka – genannte Tat an den Bedürftigen gemeint, die zählt. Mit solchen Wohltaten, die das Unwohlsein Leidender lindern, machen wir deutlich, dass diese für uns zählen. Die „geringsten Brüder“ bezeichnen dabei nicht zuerst eine soziologisch beschreibbare Schicht als Unterschicht oder eine Klasse der Deklassierten, sondern unseren „Nächsten“, also die Person, die Not leidet und einen konkreten Mangel hat: Hunger, Durst, Fremdheit, Nacktheit, Krankheit, Gefängnis – und beschreibt also in zweiter Linie durchaus Personen insgesamt, deren Existenz vielfältigen Mängeln ausgesetzt sind. Diese genannten Mängel – und überhaupt Mängel wie diese – sind gemeint und schließen dann selbstverständlich Armut, Gewalt und Krieg ein. Mitzudenken ist die Fortsetzung der Reihe: Ich bin arm gewesen und ihr habt mit mir geteilt; ich habe Gewalt erfahren und ihr habt mich beschützt; ich war im Krieg und ihr habt für den Frieden gekämpft.
Unser Gerichtsbild wendet unsere Aufmerksamkeit auf die Sorge für den konkreten Fall, in dem sich unsere allgemeine Sorgepflicht erfüllt. Wir werden nicht den Hunger auf der Welt besiegen, und noch nicht einmal Jesus hat alle Kranken, die ihm begegneten, geheilt; aber wenn uns ein Hungriger begegnet oder wo wir Kranke sehen, sind wir nach unseren Möglichkeiten zur Hilfe gefordert. Der eine zählt, jeder einzelne zählt, weil alle zählen.
Aus unseren Möglichkeiten und mehr noch aus unseren Unmöglichkeiten zur Hilfe ergibt sich Gottes Zuständigkeit für das Große und Ganze. Am Weltgericht müssten wir Menschen uns verheben, schon ein Weltpolizist mutet sich zu viel zu. Aber Gott können wir das Gericht über die Welt überlassen. Auf seine Gerechtigkeit und auf seine Gnade ist Verlass. Für ihn zählen alle Menschen.