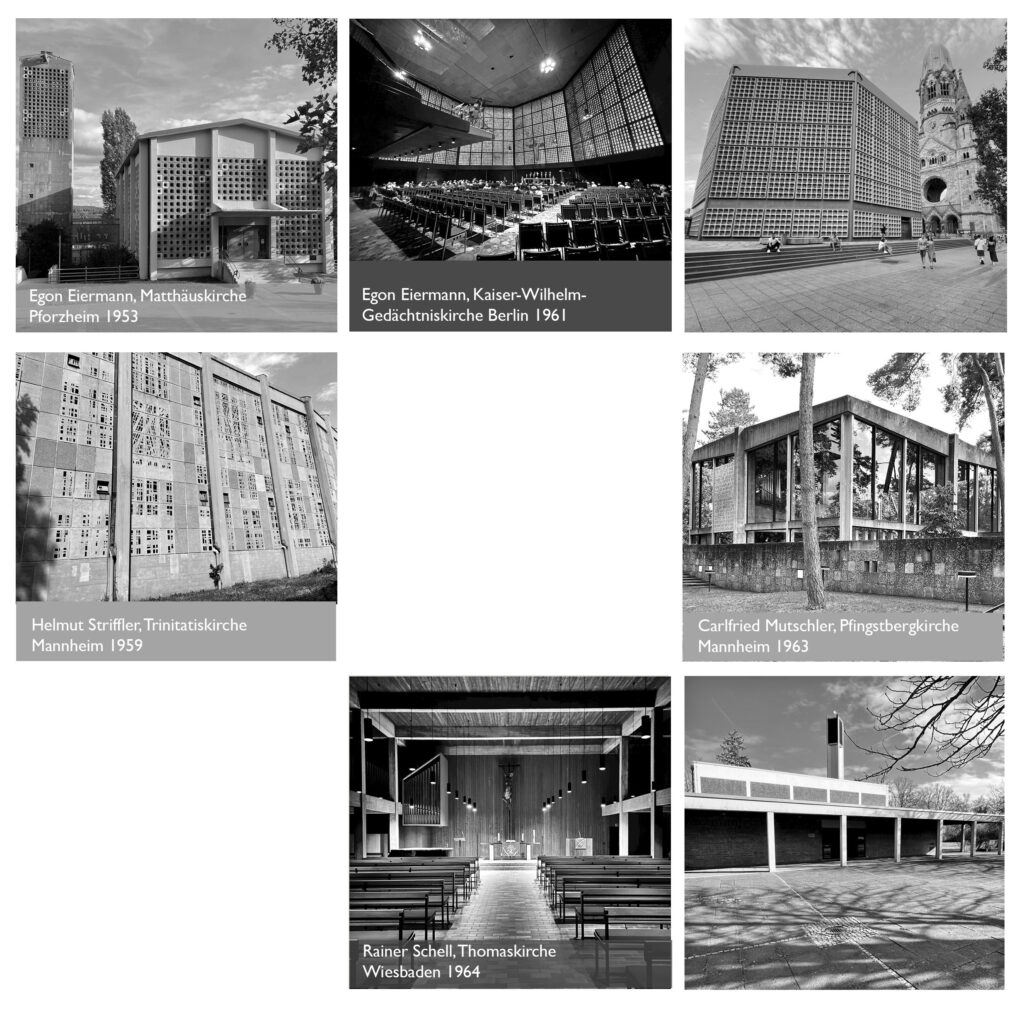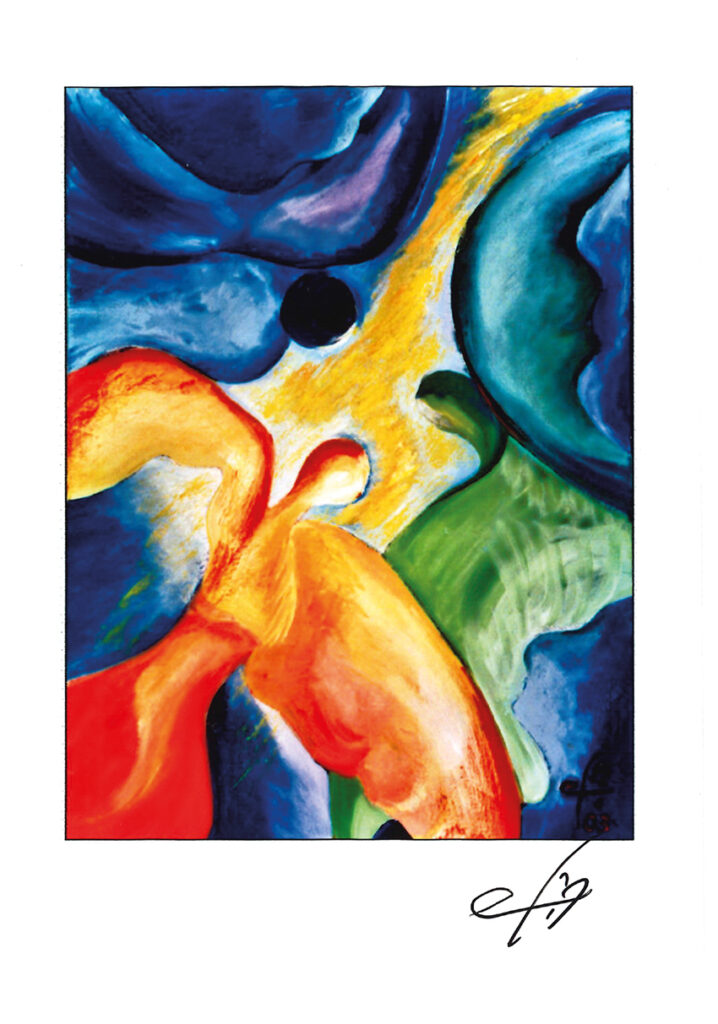Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit.
Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade.
(Brief an die Hebräer 13, 8b-9)
„Was gibt’s Neues?“ – hat mein Vater – Gott hab ihn selig – regelmäßig zur Begrüßung gesagt und gefragt. „Was gibt’s Neues?“ Das war zum einen – so habe ich die Frage gedeutet – das Interesse am Leben der Kinder, an dem er mit den Jahren ja nicht mehr direkt teilnahm; und das war zum anderen die Sorge vor schlechten Neuigkeiten, die ihn mehr und mehr beherrschte. Lange vor dem Zeitalter des „Doomscrolling“ auf unseren Telefonbildschirmen saß er eigentlich täglich vor dem Fernseher, um in langer Folge Nachrichtensendung um Nachrichtensendung anzuschauen, die ihn, auch wenn es wenig Neues gab, zuverlässig mit kleinen und großen Kalamitäten aller Art versorgten. Verstehen konnte ich das damals nicht, oft genug habe ich darauf mit Unwillen reagiert, zumal es mir wie eine Art Fluch erschien, unter dem er stand – und unter dem heute so viele von uns stehen. Nachrichten als Sucht und Fluch zugleich. Only bad news are good news.
Für mich passt das gut zu einer Redensart, die wohl entgegen einer häufigen Zuschreibung nicht, oder zumindest nicht direkt aus dem Chinesischen stammt „Mögest du in interessanten Zeiten leben!“ Und sie ist anders als es vielleicht ein erster Eindruck erscheinen lässt, nicht als Segenswunsch, sondern als Fluch gemeint. „Mögest du in interessanten Zeiten leben!“ Denn das Interessante, das Neue ist hier das, was die Betroffenen plagt. Interessante Zeiten in diesem Sinne sind schlimme Zeiten, sind Seuchen- und Hungerjahre, sind Krisen und Kriege, Umstürze, Bankenzusammenbrüche und Firmenpleiten – wir wissen, was gemeint ist. Ein bisschen langweiliger, wäre schon schön.
Ein bisschen langweiliger, wäre schon schön. Also etwa so langweilig, wie die gute Nachricht von heute klingt: Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Langeweile als Programm. Der Vers müsste ja wohl – so stelle ich mir vor – der Alptraum jeder kirchlichen PR-Abteilung sein, die sich – stets auf der Suche nach dem heißesten Scheiß – der guten alten Botschaft, des Evangeliums schämt. Immer dasselbe. Immer so weiter. Alle Jahre wieder. Langweile vertont und gesungen.
Wir folgen aber heute nicht der bisweilen kopf- und atemlosen kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit, sondern dem Evangelium selbst. Gerade jetzt zum Jahreswechsel erklingt das Lob der scheinbar langweiligen, der vermeintlich uninteressanten Verlautbarung von der Beständigkeit und der Verlässlichkeit Gottes, und sie klingt ziemlich passend. Wenn alles fällt, bleibt doch der Eine bestehen. Wenn sich alles in Auflösung befindet, finden wir festen Halt an Gott. An ihm möge unser Herz fest werden – in den Worten unseres Autors, den wir außer durch seinen Brief nicht weiter kennen.
Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit.
Diese Worte gehören zum Schlusskapitel seines Briefes an die Hebräer. Sie formulieren noch einmal prägnant die Gebrauchsanweisung seines Schreibens, so wie andere seiner Schlussworte ebenfalls zusammenfassend auf den praktischen Nutzen zielen:
Wenn er etwa das Vorübergehende unserer Existenz betont; Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Als wanderndes Gottesvolk versteht er die christliche Gemeinde; in der Nachfolge des Wanderers Jesus; im Rückblich und Anklang an das Volk der Hebräer, das sich immer als herumziehend, als nomadisch verstand, mit allen Konsequenzen für das praktische Leben.
Praxis klingt auch an, wenn es ihm um die Nächstenliebe als von den Juden erlernte christliche Grundtugend geht; Gutes zu tun und mit andern zu teilen vergesst nicht; denn solche Opfer gefallen Gott. Als erste und wichtigste Wanderregel gilt, dem anderen beizustehen – dem anderen, mit dem ich wandere, und dem anderen, dem ich begegne.
Wir könnten nun ein ums andere Thema, und zahlreiche, im Grunde jeden seiner Aussprüche betrachten – und immer würden wir erleben, dass der Autor an die Hebräer nicht auf der Suche nach Neuem ist, keine Neuigkeiten formulieren möchte – sondern in der gebotenen Ausführlichkeit und Umständlichkeit das Uralte seiner Botschaft herausstellt. Wichtig, bedeutend, gültig, sinnvoll – ist das was er zu sagen hat, nicht weil es neu ist, sondern weil es alt ist. Weil das Wesentliche das Alte ist.
Man könnte das beinahe für ein fernes Echo des Prediger Salomo halten, seines „Es gibt nichts Neues unter der Sonne“ – nur das dieser in tiefer Resignation dann gleich alles für absurd und nichtig erklärt hat: „Es ist alles ganz eitel, alles absurd, alles Windhauch, alles nichtig und flüchtig wie Kains Bruder Abel: Häbäl Habelim.“ Die Sehnsucht nach Neuem, Sucht und Fluch der neuesten Nachrichten verwandeln sich ihm in eine tiefe Skepsis am Leben, in eine beinahe zynische Lebensunlust: Alles schon geseh´n, alles schon erlebt, was soll ich dort?
Im völligen Gegensatz zum Prediger Salomo nimmt der Autor unseres Briefes an die Hebräer das Neue im Alten war, als das Alte, das wesentlich bleibt. Für ihn, wie für uns, ist dieses uralte Neue mit dem Namen Jesus Christus verbunden:
1Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, 2hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. 3Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe 4und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. (Hebräer 1)
Was gibt’s Neues? Gibt’s was Neues? Das Neue ist, dass das Uralte, von dem heute die Rede ist, gültig bleibt, weil es nicht veraltet. Der erste Anfang durch Gott bleibt sozusagen aktiv in seinem Sohn. „Schöpfung“ meint den ersten Anfang, der fortwährend neue Anfänge ermöglicht und verwirklicht. Jung bleiben wir, solange wir solche Anfänge für möglich halten. Neujahr und unsere Art es zu begehen, bezeichnen im besten Fall die kulturelle Aneignung der Kategorie Schöpfung: Siehe, ich mache alles neu! (Jahreslosung 2026). Amen.