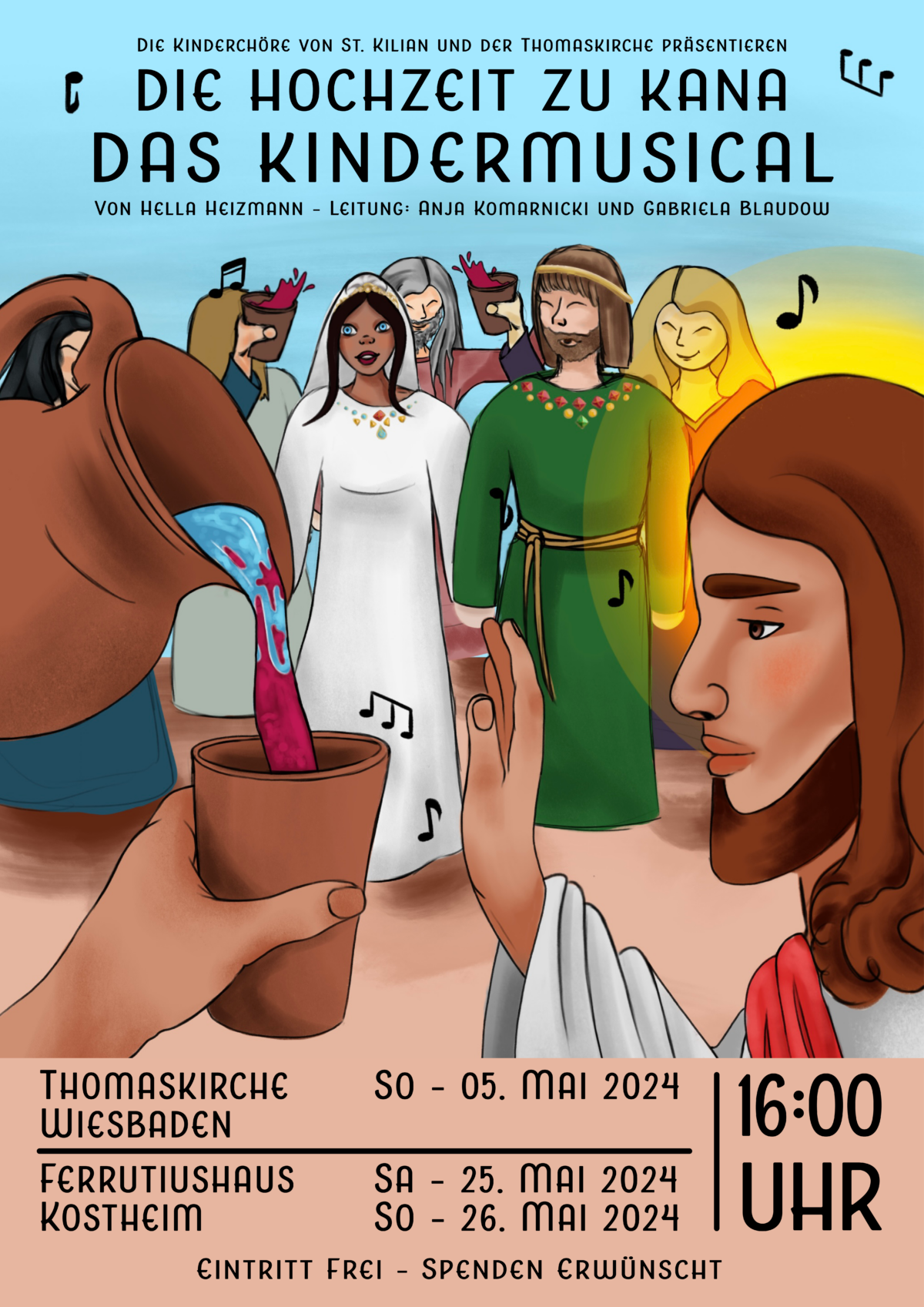Des HERRN Hand kam über mich, und er führte mich hinaus im Geist des HERRN und stellte mich mitten auf ein weites Feld; das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach: HERR, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, höret des HERRN Wort! So spricht Gott der HERR zu diesen Gebeinen: Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet; und ihr sollt erfahren, dass ich der HERR bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regte sich und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf und sie wurden mit Haut überzogen; es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir: Weissage zum Odem; weissage, du Menschenkind, und sprich zum Odem: So spricht Gott der HERR: Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden! Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel.
Siehe, jetzt sprechen sie: Unsere Gebeine sind verdorrt, und unsere Hoffnung ist verloren, und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott der HERR: Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der HERR bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen, und ihr sollt erfahren, dass ich der HERR bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der HERR.
(Buch des Propheten Hesekiel 37, 1-14)
Atem des Lebens: Der Prophet Hesekiel beschwört den Atem des Lebens, den Geist des Friedens in seiner grandiosen, aber auch verstörenden Vision.
Bevor überhaupt der Atem des Lebens über die Gräberfelder gehen kann, wehte doch der Hauch des Todes über ihnen, hatte im Fall der verwüsteten Schlachtfelder der Sturm der Vernichtung über ihnen getobt. In Verdun oder in Flandern und sicherlich an vielen anderen Orten, an denen Krieg war, lässt sich das nachvollziehen, was Hesekiel als Traum beschreibt: Gottes Geist stellte mich mitten auf ein weites Feld; das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und siehe, sie waren ganz verdorrt.
Als vielleicht 12jähriger Junge habe ich das erste Mal – wie in einem Alptraum – auf einem solchen Feld gestanden, in Verdun, wo mein Onkel, eigentlich Großonkel Karl gekämpft hatte und nun glücklicherweise nicht lag, sondern – darf ich das glauben? – durch Gottes Geist nach Hause geführt worden war; in Verdun, wo aber unzählige Menschen den Tod gefunden haben und deren Gebeine nun auf den Feldern liegen, oder – für das Kind und nicht nur für Kinder nicht weniger verstörend – in Beinhäusern gesammelt, aufgeschichtet liegen, als Erinnerung, als Warnung, als Mahnung.
Vor 110 Jahren brach die Furie des Krieges in Europa hinein, die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, die aus Feldern erst Schlachtfelder und dann Grabfelder gemacht hat – nur um gut zwanzig Jahre später noch einmal, noch furchtbarer entfesselt zu werden. Als sich dann abermals nach dem großen Schrecken Stille über den Feldern ausbreitete – Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und siehe, sie waren ganz verdorrt – sollte, so formulierten es die Christen in einer Schrecksekunde nach dem Krieg: Nach Gottes Willen nie wieder Krieg sein! Sollten keine neuen Schlachtfelder gepflügt und Grabfelder bereitet werden. Sollten Orte des Alptraums zumindest nicht mehr dazukommen. Sollte nicht mehr der Hauch des Todes, sondern der Atem des Lebens wehen.
Versöhnungen haben stattgefunden, Freundschaften wurden gestiftet. Vielfach stehen die Nachfahren der Feinde gemeinsam auf den Gräbern ihrer Eltern und Großeltern.
Auch wenn es zu keiner Zeit gar keinen Krieg in der Welt gab, schienen aber die Nachkriegsgeborenen sich doch weitgehend einig darüber, dass es so sein soll, so sein sollte: Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Meiner Generation war das ein Bekenntnis des Glaubens; dass sich der Alptraum des Krieges in den Traum vom ewigen Frieden wandelt.
So wie in dieser Vision des Hesekiel das Grabfeld der Totengebeine vom Atem des Lebens angeweht zum Ort der Wiedergeburt wird; in einem Traum vom neuen Leben, der so grotesk, so absurd, so surreal ist wie jeder Traum vom Frieden im Krieg: Dass Gebeine zusammenrücken, Gebein zu Gebein. Dass Sehnen und Fleisch darauf wuchsen und sie mit Haut überzogen wurden; dass der Odem in sie kam, und sie wieder lebendig wurden und sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer stellten? Der Traum erfüllt – im Traum! – den Wunsch nach neuem Leben und Frieden. Wenn Frieden kommt, dann ist das vom Krieg her gesehen so unwahrscheinlich und weithergeholt wie der Tanz der Gebeine auf ihren Gräbern, aber nicht weniger als gottgewollt.
Außerhalb unserer Träume – allerdings – folgt die Wirklichkeit unseren Wünschen nicht. Bloß den Frieden zu wünschen, schafft keinen Frieden, sondern macht uns zu Gefangenen unserer Träume. Andererseits den Krieg bloß mit Krieg zu bekämpfen, wird den Frieden auch nicht erreichen. Ohne Vorstellung von einem gerechten Frieden, der zu erkämpfen wäre, gibt es keinen gerechten Krieg; noch der gerechteste Krieg – nämlich der zur Verteidigung nach einem Überfall – droht sich zu verkehren. So wie wir es gerade erleben.
Die Propheten der Bibel haben die Vorstellungen eines gerechten Friedens der Kraft des Geistes Gottes zugeschrieben. Sie haben dabei Konzepte der Geistwirkung entwickelt wie Trost und Hoffnung inmitten maximaler Trostlosigkeit und Hoffnungslosigkeit – wie Hesekiel hier in seiner Gräberfeldvision: Gottes Geist des Lebens schafft ungeahnte Lebensmöglichkeiten noch in der scheinbar überwältigenden Wirklichkeit des Todes; das Gräberfeld, das Trümmerfeld ersteht zu neuem Leben.
Die Propheten haben weitere für künftige Friedensordnungen nützliche Wirkungen des Geistes beschrieben, wie Recht und Gerechtigkeit, wie Versöhnung und Vergebung, wie Großzügigkeit und Freizügigkeit. Insbesondere die Fähigkeit zur Empathie – also im Anderen, im Nächsten mich selbst zu erkennen – wird Gottes Geist zugeschrieben. Jede dieser Wirkungen kann uns selbstverständlich, ja trivial erscheinen; angewendet auf Gegner und Feind klingen sie beinahe wie ein Skandal. Aber Frieden ohne Gerechtigkeit für den ehemaligen Feind, wird es nicht geben. Und nur wenn ich ihn irgendwann für einen Menschen wie mich halte, wird er Frieden halten.
Wenn es auch richtig ist, sich nicht zum Gefangenen seiner Träume zu machen, bestehen die Propheten darauf, sich gleichfalls nicht zum Gefangenen einer vorfindlichen Wirklichkeit zu machen, sondern diese für veränderlich zu halten. So wie es jetzt ist, muss es nicht bleiben. Und die Bedingungen der Möglichkeit solcher Veränderungen bezeichnet die Bibel als Geist, Gottes Geist in uns, Atem des Lebens.